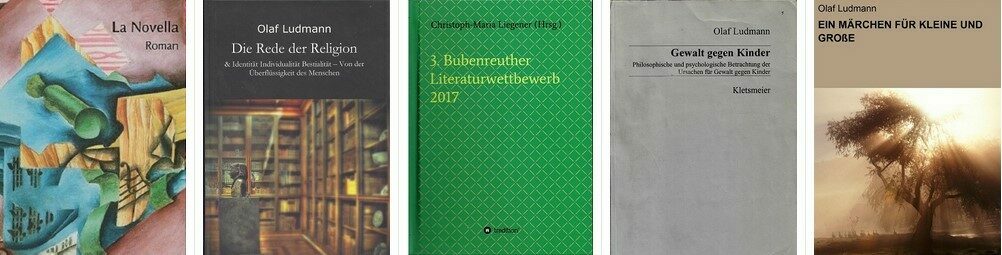Zum Leben geboren
(Auszug)
Ich denke, der Sinn unseres Lebens ist es,
Dagegen anzukämpfen, daß aus den zahlreichen
Kleinen Enttäuschungen und Ängsten,
Die eine große Verzweiflung wird.
Sie werden einen Unfall daraus machen. Denn es wird nichts von mir zurückbleiben. Kein Abschiedsbrief mit klagenden Vorwürfen und dem schäbigem Versuch irgend jemandem für mein Versagen die Verantwortung anzulasten. Ich allein bin zuständig für mich. Die Polizei kommt ins Haus, ach wie peinlich. Bohrende Fragen stellen sie, doch die Antworten werden unbestimmt und oberflächlich ausfallen. Nur im Innersten denken sie das Unaussprechliche.
Vater mag sich bestätigt fühlen. Einmal mußte es so mit mir enden. Dagegen Onkel Karl. Ihm brennt der Kopf von der Frage: Warum? Warum? Warum? Hätte er die Möglichkeit mich danach zu befragen, ich glaube kaum daß ich in der Lage wäre, es ihm einleuchtend zu erklären.
Bloß Tante Margit schweigt, weil sie ahnt worin meine Verzweiflung bestand. Hiervon kein Wort aus ihrem Mund. Weshalb auch. Schweigen ist ihre Art, den Anderen aus sich herauszulocken. Denn sie weiß, es war lang geplanter glatter Selbstmord.
Vielleicht soll es allein in meiner Vorstellung so sein. So wenig man dem eigenem Sterben zuschauen kann, so wenig vermag man den Menschen im Moment, da ihre ganze Zivilcourage herausgefordert ist, in das Herz zu blicken. Vor allem, ich bin nicht dabei. Weshalb darum kümmern.
Wenn einer freiwillig der Zukunft entsagt, gibt es für ihn nur noch Vergangenheit. Er sucht gewissermaßen den einen Fixpunkt, die Stelle im Leben, wo Hoffnung in Hoffnungslosigkeit, Vertrauen in Mißtrauen und selbstzerstörerisches Ich-Verweigere-Mich umschlägt. Von dort aus führt der Weg, verschlungen zwar aber zielstrebig, zu dem Graben über den man mit Leichtigkeit springen würde. Falls, ja falls nicht eben jene Umkehrung geschehen wäre, die bewirkt, daß man sich vor dem Weiterlaufen mehr fürchtet, als vor diesem einen und letzten Schritt.
Da stellt sich ein Problem. Angenommen, ich bin gar nicht menschsgenug die eigene Haut zu Markte zu tragen. Entweder? Oder? Ich könnte auch einfach im dauernden Schwanken verharren. Zu feige zum Leben, zu feige zum Sterben. Was hindert mich? Ich bin allein, das Messer liegt bereit und alles würde schnell gehen. Die Pulsader werde ich mir aufschneiden. Das soll am wirksamsten sein, wird erzählt. Man müßte es ausprobieren können, sozusagen als spielerischer Versuch. Der Tod als Spiel, das ist die verführerische Illusion.
Und die Wirklichkeit? Inzwischen hat das Dunkel die letzte Helligkeit davongejagt. Vorhin beim gemeinsamen Abendbrot hier in der Veranda hab´ ich es betrachtet. Unendliche schwarze Wolkenschwaden zogen dahin, als wollten sie klammheimlich das Licht unterwandern. Jetzt stehe ich einsam wieder an gleicher Stelle. Die Zigarette in der Hand, ich rauche unheimlich viel, aber es ist der einzige Halt den ich noch besitze. Ansonsten trostlose Leere und ein verschwommener Blick aus dem Fenster.
Die Haustür!
Jemand war an der Haustür. Kann das sein? Es sind doch alle schlafen gegangen. Ich muß mich ruhig verhalten. Die Kerze. Ob ich sie ausblase? Und das Messer. Es muß verschwinden, egal wohin. Ich verstecke es im Schreibtisch. Die Schritte kommen näher. Am besten umdrehen, ich merke nichts. Aus dem Fenster schauen und abwarten. Hinter mir öffnet einer die Schiebetür. Gleich darauf werden die Flügel wieder geschlossen. Es ist gespannte Stille. Wieso spricht keiner? Vielleicht läßt man mich in Ruhe. Ich weiß es nicht. Auf keinen Fall verraten. Tun, als wäre alles normal. Die Zigarette. Natürlich, ich wende mich um und greife nach dem Aschenbecher auf dem Tisch. Dann wird es sich zeigen.
„Tante Margit, du? -Hm, du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt.“
„Ja, ehrlich?“
„Wie meinst du das?“ frage ich verblüfft. Sie ist unberechenbar in ihrer Fähigkeit, Menschen zu durch- schauen. Vor ihr der studierten, erfahrenen Psychologin heißt es auf der Hut sein.
„Eine harmlose Frage“, sagt sie und tritt in den Lichtkegel der Kerze. Dicht vor mir bleibt sie stehen. Ihre hellblauen, aufgeschlossenen Augen sehen mich an und das Gesicht strahlt gutmütige Freundlichkeit aus. Furchtbar gern´ möchte ich wissen, was jetzt in ihrem Kopf herumspukt. Manchmal habe ich den dumpfen Verdacht, daß flüchtige Gesten, nebensächliche Kleinigkeiten denen andere selten Beachtung schenken ihr alles verraten.
„Ich dachte, ihr schlaft“, sage ich. Möglichst ungezwungen geben, das ist am sichersten.
„Dein Vater und Onkel Karl sind auch im Bett, aber mir war noch nicht danach. Ich mußte raus und bin deshalb im Wald spazieren gegangen. Die kühle Abendluft ist wohltuend angenehm. Außerdem entspanne ich mich bei solchen Wanderungen.“
„Bißchen riskant, du mutterseelenallein zur vorgeschrittenen Stunde.“
„Ach du meine Güte, was dürfte mir alten Frau denn passieren“, entgegnet sie und schmunzelt.
„Na also, mit fünfzig ist man ja nun noch nicht alt.“
„Ich komme in die Jahre, mein Junge. Zudem ist heute Nacht Vollmond. Komisch, das verleitet mich immer zum Grübeln.“
„Schau einer an. Und wie erklärt die Psychologin diesen Umstand?“ Ich lache. „Jedenfalls, ich kann bei Vollmond nie schlafen oder höchstens im Halbschlaf vor mich hindösen.“
„Wenn ich gemächlich laufe und in den vom Mondschein erleuchteten Nachthimmel gucke, fördert das meine Konzentration auf eine Sache, die mich beschäftigt.“
Sie läuft an mir vorbei, direkt auf das Fenster zu. Ich unterdrücke wohlweislich die Frage, womit sie sich heute bei ihrem ausgedehntem Waldspaziergang befaßt hat. Sie beabsichtigt doch etwas. Weib, warum verschwindest du nicht?
Plötzlich sagt sie zu mir gewendet: „Was hast du vor?“
„Nichts!“ rufe ich empört. Lächle aber sofort. Mir ist klar, daß es ziemlich gekünstelt wirken muß und ich fühle mich ähnlich einem ertapptem Dieb. „Du mißt offenbar der Tatsache hintergründige Bedeutung bei, ich meine, daß ich noch so spät hier alleine herumhocke. Aber dem ist nicht so. Ich habe schlichtweg nachgedacht, wie es weitergehen soll.“
„Aha. Folglich dachten wir beide an das gleiche“, erklärt sie und stützt leicht ihre Hände auf die Fensterbank. „Während meines Spazierganges bin ich nämlich zu dem Entschluß gekommen dir zu helfen, was ich sicherlich auch kann. Du wolltest doch, daß ich dir helfe?“
„Mit einemmal. Überrascht mich. Vor vierzehn Tagen kam ich her und bat dich mir beizustehen, weil ich ehrlich nicht mehr ein noch aus wußte. Du hast jedoch geschwiegen, die ganze Zeit.“ Mein Körper durchfährt ein Zittern. Wenn sie ernst macht, ich würde es nicht durchstehen.
„Du hast recht, Benjamin“, sagt sie gelassen. „Allerdings lag es daran, weil ich dich beobachtet habe.“
„Und wie sieht das Ergebnis deiner Bobachtung aus?“ Es ist klüger beherrscht und ausgeglichen zu erscheinen. Nur so kriege ich die Sache in den Griff.
„Du bist krank…“
„Ich bin nicht krank!“ falle ich ihr schreiend ins Wort. „Schlag dir das aus dem Schädel.“
„Weshalb bist du dann gekommen?“
„Aus Verzweiflung. Angst…, wer weiß.“
„Angst. Wovor oder vor wem?“
Was soll ich darauf antworten, überlege ich. Sie wird ohnehin die Sache auslegen, wie sie es braucht.
„Wohl mehr oder weniger vor der Einsamkeit. Nachdem Christine mich verlassen hatte -“
„Christine ist deine Freundin gewesen?“
„Ja. Ich fühlte mich irgendwie im Stich gelassen und wußte nicht wohin.“
Es ist unheimlich, ihr Art zu fragen. Gleich einer Zitrone preßt sie mich aus. Und ich bin willenlos ihr ausgeliefert.
„Wer hat wen in Stich gelassen? Sie dich oder du sie? Und das schon lange bevor ihr euch getrennt habt?“
„Das sind doch Hirngespinste. Woher hast du bloß solch einen Unsinn. Mein Gott, du willst mich höchstwahrscheinlich mit aller Macht zum Psychopaten stempeln.“
„Das liegt mir absolut fern. Doch ich erinnere mich, daß deine Mutter bei unserem letzten Gespräch vor ihrem Tod erwähnte, Christine hätte sich über dich beklagt. Du seist völlig abgestumpft und gefühllos.“
„O, tat sie das wirklich, man höre.“
Darüber wundere ich mich kaum. Christine besaß einen ausgeprägten Familiensinn. Sie war häufiger bei meinen Eltern als ich. Sogar Mutter hatte sie während ihres Krankenlagers gepflegt. Na ja.
„Scheinbar muß sie es erzählt haben“, erklärt Margit mit großer Bestimmtheit. „Meinetwegen“, ich zucke mit den Schultern und drücke die Zigarette im Aschenbecher aus. „Was ändert das noch. Sie hat sich ja sowieso intensiver um meine Eltern gekümmert. Ich war ein notwendiges Übel, das sie in Kauf nahm.“
„In dieser Hinsicht kann ich mir kein Urteil erlauben. So weit mir bekannt, wuchs sie elternlos auf, da ist es doch geradezu von ihrer Seite aus logisch und konsequent Anschluß zu suchen. Und die Familie des Freundes ist das nächstliegende.“
„Rührend, sehr rührend“, mir platzt gleich der Kragen. Für die anderen sind dauernd Entschuldigungen parat. „Jetzt tischst du mir garantiert die herzzerreißende Geschichte vom armen Mädchen aus dem Heim auf. Kenne ich bereits. Dauernd predigte meine Mutter die Litanei. Nimm Rücksicht, Benjamin, du mußt sie verstehen. Äußerst verständnisvoll, nicht wahr. Dennoch ziemlich fad. Christine, das beklagenswerte, unschuldige Geschöpf. Nur leider falsch. Der Ehrgeiz zerfraß sie fast. Sie wollte unbedingt den Leuten beweisen, daß die vom Heim nicht schlechter sind, im Gegenteil, was sie anfaßte gelang ihr. In jede Angelegenheit steckte sie ihre Nase hinein. Ha, ich hätte gewarnt sein müssen, als sie mir erzählte, sie studiere an der Pädagogischen Hochschule. Sie Lehrerin und ich ihr kleiner dummer Schüler.“
„Lehrer hast du nicht sehr gern? Verzeih, ein flüchtiger Eindruck von mir, belanglos.“
Kapiere schon, worauf sie anspielt. Das ist einer ihrer `belanglosen´ Fangfragen.
„Nehmen wir einmal an, ich bin nicht besonders gut auf Lehrer zu sprechen. Prompt fangen deine grauen Gehirnzellen an in Bewegung zu geraten, denn mein Vater ist Lehrer. Unser Verhältnis zueinander ist, gelinde ausgedrückt, gespannt. Seit frühster Kindheit ist er mir ein Dorn im Auge, ich gestehe es. Da lassen sich ungeahnte Rückschlüsse ziehen. Du kombinierst und siehe, die Problematik löst sich wie das Einmaleins auf. Resultat: Vaterkomplex, in der Fachsprache nennt man das wohl Ödipuskomplex. Na bitte, die Ursache ist erkannt. Schreiten wir zur Heilbehandlung. Ich strecke mich auf die Couch und du erkundigst dich nach meinen Träumen. Übrigens hatte ich vergangene Nacht einen interessanten Traum. Möchtest du ihn hören?“
Sie nickt zustimmend.
„Anfangs kaum zu erkennen, doch dann deutlich. Ich befinde mich in einer Gaststätte. Ob Gäste außer mir dort sind, kann ich nicht sagen. Sehe nur eine ältere Frau, Gesicht verschwommen. In Erinnerung ist mir ihr blondes, gelocktes Haar geblieben. Ich drehe mich um und sehe einen Hund, deutscher Schäferhund. Er springt die in das obere Stockwerk führende Treppe hinauf. Vor ihm ein kleiner Hund, auch derselben Rasse, den er zu fangen versucht. Eigentümlicherweise gehe ich den beiden Tieren nach. Gelange an eine Tür. Drücke die Klinke und komme in einen hell erleuchteten Raum. Tageslicht strömt durch die Fensterfront herein. Plötzlich bemerke ich zwei Männer, die sich miteinander unterhalten. Einer sitzt aufrecht im Bett, der zweite sitzt neben ihm auf einem Stuhl. Das Zimmer ist eng und mit altmodischen Möbeln eingerichtet, irgendwie wirkt es muffig. Das verstaubte Sofa bedecken gestickte Deckchen abgewetzte Stellen. Ungeniert hänge ich mich in das Gespräch der Männer. Sie bieten mir einen Platz an und wir plaudern unbefangen. Worüber weiß ich nicht. Ich schaue in das Gesicht des Mannes auf dem Bett und erkenne meinen Bruder. Da geht die Tür auf und der große Schäferhund kommt springend in das Zimmer. Furchtbare Angst, er könne mich beißen, fühle ich. Freiwillig strecke ich ihm meine Hand entgegen. Wahrhaftig faßt er mit seinem Maul danach, aber beißt nicht. Eigenartig starr blicken seine Augen auf mich. Entsetzt will ich fortrennen, statt dessen erwache ich aufgeschreckt aus dem Traum.“
Ruhe. Nach einer Weile sage ich: „Vermagst du den Traum zu deuten, Tante Margit?“ Aber sie schweigt. Ihre Augen nehmen einen starren Ausdruck an. Sie schaut und schaut. Der Hund, die Augen des Hundes. Das macht mich verrückt. „Tante Margit!“ rufe ich erregt. „Sag´ etwas. Woran denkst du?“
„Lassen wir deinen Traum für einen Moment beiseite“, sagt sie und ich bin froh, daß sie dieses unerträgliche Schweigen bricht. „Weshalb erzählst du mir die Geschichte? Ich vermute, um mich abzulenken, du möchtest mir ausweichen. Deine Abwehr ist verständlich, sie ist gewissermaßen die beharrliche Reaktion des aufgeschreckten unbewußten Ich gegen jegliche Angriffe von außen. Aber über eines mußt du dir im klaren sein, Benjamin. Ich kann dir nur helfen, wenn du bereit bist die Hilfe anzunehmen. Lehnst du sie ab, wird es zum zwecklosen Unterfangen. Gegen dich zu arbeiten, bringt uns kein Stück voran.“
Sie gibt einen tiefen Stoßseufzer von sich. Wahrscheinlich enttäuscht wegen meiner Starrköpfigkeit. Sie geht hinüber zum Eßtisch und rückt einen Stuhl schräg, damit sie beim Sitzen in meine Richtung blicken kann.
„Was soll jetzt werden?“ frage ich unentschlossen.
„Die Entscheidung triffst du“, höre ich sie sagen.
Gibt es überhaupt etwas zu entscheiden? Ich würde mich selbst belügen, glaubte ich daran. Die Vorstellung eine Wahl zu besitzen ist verlockend, dennoch reine, törichte Einbildung. Zwischen dem Messer im Schreibtischfach und ihrem Angebot kann es niemals ein faires Abwegen geben. Solange der Mensch lebt und auch nur der geringste Funke von Hoffnung in ihm lodert, wird der Wunsch nach dem Tode unterliegen. Leben heißt Lust, dagegen wer verspürt bei Sterben und im Tod schon Lust. Vorausgesetzt es geht schief, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
„Woher weiß ich, daß eine Chance besteht, mein jetzige Situation zu überwinden? Eventuell bin ich gar nicht krank in dem Sinne wie du es meinst, sondern es ist eine, sagen wir, zeitweise Verstimmung. Was dann?“
„Eben genau dies müssen wir herausfinden. Selbst, nach deiner Bezeichnung eine `zeitweise Verstimmung` hat ihre Ursachen und sie zu erkennen dürfte von Nutzen sein.“
„Will ich ja keinesfalls bestreiten“, bestätige ich. Trotzdem ist mir unwohl dabei.
„Ich meine, wir sollten zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die Frage lautete: Wer hat wen in Stich gelassen?“
„Wie das klingt, als ob jemand Verrat geübt hätte. Der Kern liegt woanders.“
„Gut, formuliere ich es direkter. Hast du sie geliebt?“
„Ha, geliebt. Was ist Liebe?“
„Du weißt es nicht?“
„Ehrlich gestanden, nein. Wobei für mich unersichtlich ist, ob ich es nur gegenwärtig nicht weiß oder vielleicht nie richtig wußte. Begreifst du das?“
„Meine Begriffsfähigkeit ist hier indiskutabel. Du mußt lernen deine Empfindungen konkret beim Namen zu nennen, sie dir bewußt zu machen und deinem Verstand zugänglich.“
„Du verlangst halbes Heldentum, das Absolute, die vollkommene Selbstbeherrschung. Doch ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch. Es sind unerklärliche Dinge, die in mir vorgehen.“ Schmerzender Druck an meinen Schläfen behindert meine Konzentrationsfähigkeit. „Kannst du dir ein Leben ohne Liebe und Hoffnung vorstellen?“
„Kaum. Und gewiß kann das niemand.“
„Siehst du, das sage ich mir fortwährend. Und ich probiere es immer aufs Neue, ungeachtet dessen bin ich meistens eher gleichgültig. Unzählige Dinge des Alltags lassen mich unberührt. Manchmal denke ich, meine Leben zieht an mir vorbei, wie der kalte Herbstwind. Leben findet für mich morgen statt und selten heute. Alles was ich empfinde, denke ich gelegentlich, sind in Wahrheit geheuchelte Gefühle, denn was in mir tatsächlich vorgeht, bleibt mir verborgen.“
„Deine Situation ist komplizierter, als ich vermutete. Ich muß deshalb einen Schritt weiter gehen. Bist du zur Liebe überhaupt fähig?“
Entsetzlich wie tief sie in mich eindringt. Davor fürchte ich mich am meisten, daß ich es muß und sogar fertig bringe geheimstes auszusprechen. Mir wurde doch nie gesagt, was Liebe ist. Alles muß man im Leben lernen, abgesehen von den wirklich wichtigen Dingen, die gibt uns ja angeblich die Natur mit. Wo wird das hinführen?
„Vor Jahren“, fange ich ausschweifend an zu erzählen, um Zeit zu gewinnen, „glaubte ich noch an Liebe, Treue und wie diese herrlichen Gefühle, Empfindungen sonst noch heißen von denen jeder spricht, aber eigentlich niemand von dem bestimmenden Einfluß dieser Werte auf unser Leben tatsächlich überzeugt ist. Sie sind die faulenden Feigenblätter einer verdorbenen Welt. In meiner Schulzeit liebte ich ein Mädchen. Einmal schrieb ich ihr einen hingebungstriefenden Liebesbrief. Er war das unverhohlene Eingeständnis meiner Sehnsucht nach ihr. Tausend Ergüsse schmachtender Leidenschaft. Selbst vor Gedichten schreckte ich nicht zurück. Lauter betörende Sprüche, wie sie in dem aufgewühlten, verwirrten Hirn eines fünfzehnjährigen entstehen. Zwei Tage nach dem ich den Brief heimlich in ihren Ranzen gesteckt hatte, redete sie mich auf den Schulhof an. Sie stand vor mir in ihrem bunten, leichten Sommerkleid, welches mir besonders gefiel. Ihr feines, dunkelblondes Haar bedeckte ihre Schultern. Diesen Gesichtsausdruck, als sie mich ansah, vergesse ich niemals. Es war eine Mischung zwischen nachdenklichem Ernst und belustigender Heiterkeit. Paradox, noch heute narrt die Wunschphantasie mein Erinnerungsvermögen. Egal. Ich fieberte gewissermaßen meiner ganz persönlichen Erlösung entgegen. Nur ein Lächeln von ihr und es wäre lindernder Balsam für mein wundes Herz. Aber sie putzte mich nach allen Regeln der Kunst runter. Was ich mir herausnehmen würde und ob bei mir noch alle Tassen im Schrank wären. Du kennst das, die üblichen Floskeln. An einem Satz kann ich mich erinnern, den sie sagte. Er hatte etwas originelles an sich. `Benjamin, wie das schon klingt, reimt sich mit Weichling´, sagte sie. Grinse ruhig, liebe Tante. Ja, in gewisser Hinsicht gebe ich ihr recht. Ich neige zur Sentimentalität. Gern wäre ich der harte Mann, der zupackt, wenn´s nötig ist dreinschlägt und mit großzügiger Gelassenheit über Bagatellen hinwegsieht. Doch ich bin nicht der Typ dafür. Mich wirft jeder Scheiß um. Damals und jetzt. Gleich einem begossenem Pudel ließ sie mich stehen. Die Angelegenheit ist damit erledigt, dachte ich. Denkste, dann ging´s erst los. Während ich noch verdattert herumstand, zeigte sie ihren Freundinnen den Brief. Sie tratschten und kicherten. Ihre Blicke zu mir herüber waren vergiftete Lanzen, die sie unbarmherzig und höhnischen Genusses gegen mich schleuderten. Ich wurde zum Gespött unserer Schule. Dafür habe ich sie gehaßt. Schlagartig wurde aus dem geliebten Wesen eine blöde, verächtliche, dumme Ziege. Unversehens verwandelte sie sich in meinen Augen. Ihre Haare verloren jeglichen Glanz, sie hingen strähnig herab. Ich bemerkte, ihr Mund war viel zu breit und ich fand ihre Beine wenig anziehend, sie stachen ähnlich steifen Stelzen unter ihrem Kleid hervor, das mir ziemlich verwaschen und abgetragen erschien. Am schlimmsten jedoch bedrückte mich das Gefühl des Verlassenseins. Wieder weggestoßen und einsam. Nichts mehr, wofür es lohnte sich anzustrengen. Die Einsamkeit ist der widerlichste Zustand menschlicher Existenz. Dagegen habt auch ihr neunmalklugen Psychologen kein Mittel.“
Margit umfaßt ihre schmale goldene Halskette und schlägt die Beine übereinander. Wippend bewegt sie ihren rechten Fuß.
„Dir hat es wohl die Sprache verschlagen?“ frage ich stichelnd, beinah hämisch.
Vergebliche Mühe. Margit bringt nichts aus dem Konzept. Nein, sie ist immer ausgeglichen. Einerseits bewundere ich sie deshalb, andererseits bringt mich das zum rasen, ihr ständiges Vernünftig sein.
„Das Wort Einsamkeit besitzt vielerlei Bedeutung.“ Mit ihrer Zungenspitze befeuchtet sie die trockenen Lippen. „Unzählige Menschen auf der Welt sind einsam und das im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Mensch der sich um sie kümmert und bemüht. Abgeschlossen und ohne Kontakte leben sie. Häufig ist der Fernseher ihr einziger Bezugspunkt zur Umwelt. Allerdings diese Form der Einsamkeit dürfte in deinem Fall außer Betracht liegen.“
„Fang mir bloß nicht von der inneren Einsamkeit an. Nach dem Motto, ich sei der leidende Unverstandene. Das kannst du dir gefälligst abschminken. Die Tour zieht bei mir nicht.“
„Fühlst du dich denn verstanden und akzeptiert?“
„Freilich, ich habe keine Schwierigkeiten mit meiner Umgebung klar zu kommen.“
„Gestatte, aber daran kommen mir erhebliche Zweifel. Du bewältigst nicht mal deine persönlichen Probleme. Glaubst du ich bin blind?“
„Quatsch!“ rufe ich. Nervös beginne ich im Zimmer herumzulaufen.
„Du sagtest gerade, du hättest Angst vor der Einsamkeit. Es wäre, meiner Ansicht nach präziserer vom Alleinsein zu reden. Ich denke, du hast Angst mit dir allein zu sein. Jawohl, du fürchtest dich vor deinem wahren Ich, weil es belagert wird von einem Geschehen in der Vergangenheit. Welches zwar in dein Unterbewußtsein verdrängt wurde, trotz alledem dich beherrscht und dir selbst fremd bleibt. Wir sollten den versperrten Zugang freilegen, es zumindest versuchen an Hand einer zwanglosen…“
„Nein, verdammt noch mal!“ unterbreche ich sie brüllend. „Nimm wegen mir deine Patienten als Versuchskaninchen. Du gehst mir auf die Nerven. Hau doch endlich ab! Merkst du denn nicht, daß diese ewige Bohrerei tiefer und tiefer mich quält. Ihr Seelenklämpner seid grausamer als der Henker. Er macht es kurz und schmerzlos. Doch ihr wühlt mit sadistischer Wollust im Inneren des Menschen herum, wie die Blutsauger benehmt ihr euch. Mir ist total schnuppe, was früher passierte. Ich weiß es nicht und verzichte auch darauf. Schlafende Hunde soll man in Ruhe lassen.“
Warum weiter Versteck spielen. Hastig gehe ich auf die gegenüberliegende Seite des Zimmers zum Schreibtisch. Heftig und mit geballter Wut im Bauch ziehe ich das Fach heraus und greife nach dem Messer. „Schau her! Ich wollte mich diese Nacht töten, wenn du es genau wissen willst. Und ich werde es hinter mich bringen, gleichgültig wann. Zufrieden?“
„Wie günstig, das Messer kommt mir sehr gelegen“, sagt sie unerschrocken und ich habe gar keine Gelegenheit mich in eine noch blindere Raserei zu steigern. „Leih es mir bitte. Ich will mir nämlich eine von den köstlichen Orangen schälen.“ Sie langt nach dem Holzteller, der auf dem Eßtisch steht.
Ist die Frau gesund? Bei wem setzt es hier aus? überlege ich krampfhaft. Mit einem Satz bin ich bei ihr. Aufgeregt halte ich das Messer zwischen den Fingern. Die Spitze nah an ihrer Brust. „Da, schneide deine köstliche Orange, sonst machst du dir noch die zarten Fingernägel kaputt.“
„Danke. Ich beeile mich, denn Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten.“
„Spar´ dir deinen Sarkasmus. Aber scheinbar gefällt dir diese Rolle des überlegenen Spötters.“
„Habe ich den dramatischen Auftritt zerstört. Und es tut mir beim besten Willen nicht leid. Komm zurück, Benjamin, auf den Boden der Realität! Freitod ist der simpelste Weg und ziemlich banal.“
„Wie gemein du sein kannst, das hätte ich nie gedacht. Sieht so deine Hilfe aus?“
„Zum Donnerwetter!“ bricht es aus ihr heraus, begleitet von einen Faustschlag auf die Tischplatte. „Was bildest du dir ein? Wir veranstalten doch keine Theatervorführung.“ Jetzt habe ich sie doch leicht verärgert. Sie erhebt sich. „Wir drehen uns im Kreise.“
„Das geht immer in die Hosen, Tante Margit. Ich bin ein aussichtsloser Fall. Christine hat es einst auch probiert. Es war bestimmt lieb und nett gemeint. Bloß ihr ständiges Drängen, ich möge mich zusammenreißen und wenigsten greifbare Ziele ansteuern, stieß bei mir auf taube Ohren. Immer fragte ich mich nämlich, welches Ziel denn lebenswert ist. Reichtum? Wohlstand? Die Karriere in einer menschlich zerbröckelnden Leistungsgesellschaft? Besteht darin die Erfüllung? Für sie war das sich etwas leisten können, materieller Besitz ein Zeichen von Erfolg. Ich werfe ihr das nicht vor. Christine wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Das prägt und machte sie gefügig für die Reize des Geldes. Im Innersten ihres Herzens verachtete sie mich, ich weiß es. Für sie war ich der verwöhnte Sohn aus gutbürgerlichem Hause, der Not nur vom Hörensagen kennt. Redete ich über Waldsterben, Umweltverschmutzung, Aufrüstung über diese verkorkste Gesellschaft, die daß Geld zum anbetungswürdigen Gott erhebt, dem sie ohne Unterlaß Opfer darbringt, dann war das in ihren Augen der Ausdruck von Dekadenz. Einer typischen Dekadenz, der geistig verdrehten Bourgeoisie, die sich des Überflusses wegen auf Nörgelei und Katastrophenhellseherei verlegt habe. Meine Zweifel, wie ich leben soll, wenn die Welt um mich herum stirbt, deutete sie als intellektuellen Hochmut. Doch ihr blieb verschlossen, wie sie so in Wahrheit die eigenen Zweifel, den letztlich alle Menschen der westlichen Zivilisation in sich tragen, nur verdrängte. Wir verharren am Abgrund, das glorreiche christliche Abendland unschlüssig was zu tun ist. Springen oder lässig fallen lassen. Vielleicht kommt eine neue Art von Barbaren und sie werden unserer verlogenen Kultur den tödlich erlösenden Tritt versetzen. Das Chaos, der Wahnsinn regiert schon. An allen Ecken und Enden kracht´s. Mord, Todschlag, Folter, Entführungen, Terror, Kriege, Aufstände, Unruhen wohin man blickt. Um die Befriedigung primitiver Machtgelüste zu gewährleisten, ist jedes Verbrechen erlaubt. Du willst mir weiß machen ich sei krank. Wunderbar, warum nicht, in dieser verrückten Zeit ist das keine Schande. Schande ist dieses Leben, um das wir normalsterblichen Bürger betrogen werden. Ihr Wissenschaftler doktert an Symptomen herum, doch die Ursachen, warum einen das Leben dermaßen anekelt, die bekämpft ihr nicht. Rundherum Mauern gegen die wir vergeblich anrennen. Es lohnt nicht mal mehr sich aufzuregen.“
Müde geworden und deprimiert von meiner trostlosen Hoffnungslosigkeit winke ich ab. Erschöpft horche ich in mich hinein, ob nicht trotzdem bescheidene, natürliche Regungen, und seien sie noch so schwach, meine erbärmliche Gleichgültigkeit erschüttern. Enttäuschung, meinethalben beliebige Formen von Aufbegehren mir würde das Gefühl von Ohnmacht vollauf genügen. Aber ich empfinde nur stumpfe Apathie. Ausgelaugt, wie eine vertrocknete Zitrone, der passende Moment zum wegwerfen.
„Du bist von einer sonderbaren Redseligkeit und mit welchem Geschick du deine Worte zu setzten weißt. Erstaunlich, wie immer das worüber du erzählst darauf hinausläuft von dir wegzuführen. Vermeintlich denkst du deine Schwierigkeiten zu meistern, indem du wortgewaltige Schutzdämme errichtest.“ Margit runzelt ihre Stirn, als wolle sie mich damit zu einer Reaktion auffordern. Einen Teufel werde ich tun. „Aber das ist in Wirklichkeit Flucht“, fährt sie fort. „Fliehe wohin du willst, es ist nutzlos. Gestehe dir selbst ein, du kannst all das, woran du den Glauben verloren hast, erst zurückgewinnen, wenn du deine Psyche von der Last befreist, die sie niederdrückt. Und ich bin felsenfest überzeugt, was du über den Zustand unserer Gesellschaft äußertest sind teilweise Projektionen deiner psychischen Verfassung auf die Welt. Ersatzschauplätze sozusagen, für die verweigerte persönliche Vergangenheitsaufarbeitung.“
„Willst du behaupten, Umweltzerstörung, Krieg und sonstiger Kram sind meine Erfindung?“
„Falsch! Ich behaupte lediglich, daß du rhetorische Ausflüchte verwendest und dies haarscharf berechnend. Kraß gesprochen, bietest du hervorragend geplante Zurschaustellungen, in denen unverhoffte Begebenheiten grandios eingebaut werden. Sämtliche Handlungen wägst du sorgfältig ab, und ich wage die Behauptung, daß mein Erscheinen dir durchaus willkommen war, um noch deinen Abgang zu inszinieren.“
Ihre Augen sind eindringlich auf mich gerichtet. Ich lese in ihnen. `Denke nicht, du kannst mir so billig entwischen´, steht dort geschrieben. Margits Worte sind das Ereignis, durch welches mein beschwerlich zusammengezimmertes Verhaltensgerüst zum Einsturz gebracht wird. Vermeintlich fühle ich in mir sogar das Krachen des Gebälks, während es kippt. Die Totenbleiche steigt mir in meine Wangen. Unwillkürlich erinnere ich mich an das alte Märchen vom Rumpelstilzchen, als die Königin mit unschuldsvoller Mine ihm seinen geheim gehaltenen Namen nennt.
„Das hat dir der Teufel gesagt!“ rufe ich mit erhobenen Augenbrauen und Margit fragt verdutzt: „Was ist los?“
„Das hat dir der Teufel gesagt“, wiederhole ich und kann mich nicht zurückhalten auch den Rest hinten anzusetzen, „schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß es bis an den Leib hinein fuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riß sich mitten entzwei. – Die Geschichte vom Rumpelstilzchen“, sage ich und wende mich von ihr ab. Im Fensterglas sehe ich mein Spiegelbild.
„Ach ja, und du bist jetzt Rumpelstilzchen, der seines Geheimnisses beraubt wurde.“
„Nicht gänzlich, Tantchen, das Mitten-Entzweireißen hast du drastischer besorgt.“
„Benjamin, welches Schauspiel ist das nun wieder?“
„Irrtum, nix Schauspiel. Ich trotze nur deiner auf Biegen und Brechen betriebenen Wahrheitsfindung. Ich und du kommen nicht zueinander, weil wir verschiedene Ebenen bevorzugen. Den Verstand du und ich die Gefühle. Und dazwischen Brücken zu schlagen ist verteufelt schwierig. Nebenbei, was bezweckst du und worin besteht der Sinn einer imaginären Wahrheit nachzujagen?“
„So will ich mich erklären.“ Ihre Stimme klingt gedämpft. Überraschend taucht sie zur Linken von mir auf und umfaßt mit den Händen meinen Oberarm. Ihr warmer Atem streift meine Gesichtshaut. Am liebsten möchte ich Margit um den Hals fallen und in milder Geborgenheit versinken. Doch die Hemmschwelle ist zu hoch. „Ich muß darum etwas ausholen, eingestandenermaßen theoretisieren“, sagt sie und es braucht einige Zeit bis der Umschwung mir ins Bewußtsein dringt. Margits Sachlichkeit erdrosselt jedwede aufkeimende Gefühlsbeziehung. „Meines Erachtens, besteht eine Art Ausgewogenheit zwischen positiven und negativen Verhaltensgrundlagen beim Einzelnen. Ich glaube nicht, daß es von Geburt her den Bösewicht und den fehlerlosen Guten gibt. In jedem ist das Potential abgestufter Veranlagungen vorhanden. Welche zum unverwechselbaren Element seines Charakters werden, hängt entschieden von dem Menschen und der ihn beeinflussenden Umgebung ab. Auch die Erziehung ist wesentlich, vor allem die Erziehung. Zum Beispiel ein glänzender Redner, kann mit Begabung und der Fähigkeit sich gewählt auszudrücken Haß und Zweitracht säen. Bei geschulter Handhabung, bringt er es fertig die Menschen gegeneinander aufzuwiegeln. Umgekehrt kann er Frieden stiften, schlichtend eingreifen und die gemeinschaftliche Toleranz fördern. Letztendlich wird die individuelle Beschaffenheit davon geprägt, inwieweit die Umwelt ihm gestattet das Humane seines Ichs über den unausbleiblich angeborenen, lebensfeindlichen Zerstörungstrieb hinauswachsen zu lassen. Der Mensch soll sich entfalten, seinen Möglichkeiten entsprechend verwirklichen und so nach der Vollkommenheit streben, zu seinem Gewinn und dem seiner Nächsten.“
Skeptisch schiele ich auf Margit herab. Hierbei bemerke ich leicht gerührt, was für eine schmächtige, zerbrechlich wirkende und körperlich kleines Persönchen Margit ist. Sie reicht mir knapp bis zum Kinn.
„Brillant gesprochen und voller Idealismus“, entgegne ich leicht zynisch, starr im Ausdruck und ohne die geringste Bewegung auf meinem Gesicht. „Aber das sind philosophische Grundsätze, kaum die des Lebens.“
Margit ficht das wenig an, denn sie ist noch nicht am Schluß.
„Wenn diese immanent menschlichen Bedürfnisse verkümmern, ausdürren und somit nicht zum Tragen kommen, oder wer den Glauben an sie eingebüßt hat ist krank. Sein Geist, seine Seele wurden annektiert von Kräften, die der natürlichen Bestimmung zuwiderlaufen. Es entwickelt sich eine substantielle Verdrehung. Aus Zärtlichkeit wird Lust am Schmerzzufügen, Brutalität; Liebe schlägt um in Haß; Mitleid entartet zu Schadenfreude und der Unfähigkeit zum Betroffensein. In den Feldern, die von den humanen Eigenschaften geräumt werden, erfolgt eine Ausbreitung des zügellosen Frevels. Das Vakuum gibt es nämlich hinsichtlich der Psyche nicht. Je mehr der Mensch von seiner Veranlagung zur Humanität opfert, desto gewaltiger fesseln ihn die Mächte der Entfremdung. Und diese Unterwerfung ist total. Da hilft weder Flucht noch Verdrängen und kein Messer. Zudem wäre es nur ihr Triumph. Weil ihre Botschaft Kälte, Verachtung, Egoismus und Rücksichtslosigkeit also Unmenschlichkeit heißt. Man besiegt sie schwerlich allein aus sich heraus. Die Wurzeln der Entstehung von Verwirrungen haben ihren Ursprung außerhalb des Betreffenden. Frühkindliche, zumeist abscheuliche Erlebnisse, deren Verarbeitung der unreifen Psyche unmöglich sind und mangelndes Einfühlungsvermögen.“
„Wieder eine neumodische, abstrakte Worthülse“, erkläre ich gelangweilt.
„Aber haben wir den Ursprung entdeckt“, setzt Margit nach einer Pause hinzu, „welcher zwar als Geschehen unauslöschbar ist, kann man aber die entstandenen psychischen Entgleisungen korrigieren. Durch Vernunft und Verstand dem sittlichen Orientierungsverfall und der Sinnverarmung Einhalt gebieten. Wieso vertrittst du den Standpunkt Liebesunfähig zu sein? Wer hat dir deinen Glauben, dein Empfinden für den Mitmenschen, für dein Menschentum generell genommen? Darauf muß es Antworten geben, auch wenn diese weh tun.“
Weshalb zwingt sie mich in diese Richtung? denke ich argwöhnisch. Karitative Manie? Erkenntniseifer? Was bin ich noch in ihrer Sucht nach Aufklärung? Das lebendige Wesen oder vielleicht und hauptsächlich das Studienobjekt, an dem die Realitätsbezogenheit und der Genauigkeitsgehalt ihrer aufgestellten Lehrsätze bewiesen werden soll. Allenthalben davon keine Silbe zu ihr, der Zweifel bleibt mein. Dagegen sagend: „Ich könnte jetzt etwas zu trinken vertragen. Vom ständigen Schwatzen ist mir schon die Kehle trocken.“
„Oha, eine prächtige Idee. Wir haben feine Sachen im Schrank und ein gutes Tröpfchen in Ehren kann nicht schaden. Will ich doch Mal schauen“, ruft sie mit fast kindlicher Begeisterung und in die Luft gestrecktem Zeigefinger. Sie verschwindet. Ihr hinterdrein blickend wundere ich mich. Wie war das möglich? Margit hätte sich im Grunde genommen gestört, übertölpelt fühlen müssen, wegen meines abrupten Wechsels. Diese Ausdauer, ihre Geduld sind zermürbend.
Gläserklingen kündigt ihr Wiedererscheinen an. Einem Schatten gleich, der sich zu einer lebenden Gestalt mausert, schreitet sie aus dem Dunkel des Eßzimmers in den Lichtschein der Kerzen. Schmunzelnd blinzelt sie zu mir herüber, während die gewölbten Likörgläser auf dem Schreibtisch ihren Platz finden. Mit nach vorn gebeugtem Oberkörper verteilt sie das bräunlich schimmernde Getränk.
„Ausgezeichneter Ouzo“, sagt sie und schraubt den Verschluß auf die Flasche, „der schmeckt. Trotzdem, Vorsicht. Seine Wirkung ist langsam, aber verheerend. Bei übermäßigem Genuß und hier oben angelangt“, wobei sie sich an die Schläfe faßt, „schlägt er zu, gnadenlos.“
„Was für Zeug ist das? Auzo, nie gehört.“
„Ouzo“, verbessert Margit, die Betonung auf das O legend, „griechischer Anisbrandwein. Ein Mitbringsel von unserem Sommerurlaub. Karl hat ihn eines Tages ange- schleppt. Ich kraxelte Hügel aufwärts zur Akropolis und mein Göttergatte amüsierte sich derweil in irgendwelchen Spelunken. Heruntergekommene Ruinen reizen ihn nicht“, sagt sie, gleichsam mit den Schultern zuckend. „Koste!“ ermuntert sie mich, die Hände gebärdenreich bewegend.
An dem dargebotenem gefüllten Glas schnuppernd, erregt das Unbekannte Scheu in mir.
„Prost!“
„Prost!“ und ich nippe anfangs nur.
„Eines würde mich interessieren“, setzt sie an, obwohl das herunterschlucken des Branntweines sie beim Sprechen behindert und sie deshalb eine kurze Pause einlegen muß, „falls es dir recht ist. Ich meine, wir sollten ein Ergebnis anstreben, deinetwillen. Was ich fragen wollte, kam es vor daß die Erinnerung an Ereignisse, egal welches, dich zurück hielt dein wahres Gefühl auszuleben?“
Beharrlich und stur, wie eine Klette hängt sie an mir. Fürchterlich, das Treiben und weiter Treiben, um doch bloß wieder und wieder mir zu begegnen.
„Ich weiß nicht worauf du hinaus möchtest“, sage ich hart.
„Angenommen, du bist in einer Situation die prompte Reaktion deinerseits erfordert und plötzlich bestürmen dich Erinnerungen, deren Herkunft du nicht kennst, aber sie veranlassen dich zu völlig anderem reagieren als beabsichtigt.“
„Welch verwirrende Konstruktionen du austüftelst. Blanker Nonsens.“
„Nein, nein! Verkneife dir diesmal sämtliche Ausflüchte. Gab es solche Momente?“
Natürlich, es gab. Allerdings mit keinem Menschen werde ich jemals darüber reden können. das ist nur bedingt der Scham wegen so, wichtiger ist mein Wissen auf Unverständnis zu stoßen und der zwang- haften Besessenheit der anderen mich umstülpen zu wollen, um mir den Pfad der Anpassung zu ebnen. Direkt so werde ich es ihr sagen.
„Laß die Dinge auf sich beruhen und versuche nicht länger mich begreifen zu wollen“, erwidere ich und schon beim Aussprechen merke ich, meine tatsächlichen Gedanken sind nicht vermittelbar.
„Doch, ich möchte dich verstehen -“
„Um mich umzukrempeln. Du willst einen gefügigen Anstandsbürger aus mir basteln“, unterbreche ich sie, in der Tonlage schwankend zwischen barscher Abweisung und unterschwelligem Schuldgefühl ihr gegenüber.
„Das unterstellst du mir. Und genau dies ist der Punkt. Dein verletzendes Mißtrauen, Benjamin. Glaubst du wirklich, ich wollte dich eilfertig umkrempeln? Aus plumper Einfalt, aus Wichtigtuerei meinerseits? Weit gefehlt, mein Junge. Dir helfen will ich, daß du endlich der sein kannst, der Du bist. Darin sehe ich den Sinn unserer Unterhaltung. Als du hier ankamst und du an jenem abend sagtest, `Bitte hilf mir´, da war das der Wink mit dem Zaunpfahl gewissermaßen, und ein Vertrauensbeweis. Denn nur wenige Leute bringen die Courage auf freiwillig laut und vernehmbar einzugestehen: Ich bin am Ende, bitte hilf mir. Dieses Bekenntnis verlangt Überwindung. Es ist ein Offenbarungseid, aber er zeugt von Stärke, keinesfalls von Schwäche. Ein Rückzieher im jetzigen Moment wäre verhängnisvoll.“ Sie atmet seufzend durch. Dann sagt sie, etwas zurückhaltender, wie mir scheint auch mit einem Anflug von Traurigkeit: „Ihr beiden, dein Bruder und du, ward für mich immer die liebsten Menschen. Bereits früher, da wir alle in Berlin wohnten und die Entfernung bis zu eurer Wohnung ein Katzensprung war, hatte ich euch ins Herz geschlossen. Freundliche, aufgeweckte Kinder seid ihr gewesen. Wir tollten ausgelassen miteinander herum. Gelegentlich schlugt ihr die närrischsten Kapriolen. Oder wer hat Angst vorm schwarzen Mann zum Beispiel, bereitete euch unsäglich viel Spaß. Vor allem entsinne ich mich lebhaft deiner Kasperletheatervorstellungen. Abendfüllende Stücke wurden von dir aufgeführt. Hexen, Teufel, der Kasper, Gretchen, die Großmutter, gespenstische Fabelwesen und insgesamt eine bizarre Märchenwelt, die wohl nur reine kindliche Unbefangenheit so vielfältig hervorzuzaubern vermag. Dieses Talent zur Inszenierung ist imponierend.“
Ihr schelmisches Lächeln, gibt mir zu verstehen, das `ist´ war bedacht gewählt und ich konnte es mir denken warum. Was ja bedeutet, daß sie mich genaustens eingeschätzt hat in meiner Gerissenheit.
„Zweifellos verband sich bei der darstellerischen Umsetzung der Geschichten bübische Pfiffigkeit mit Begabung. Erstaunlich für das Alter. Maximal sechs oder sieben Jahre warst du. Ha, wenn ich daran denke, für jede Aufführung erhielten wir Extraeinladungen, bunt bemalte Karten, versehen mit der dringlichen Aufforderung um pünktliches Erscheinen. Barbara und ich waren es auch, da kannst du nicht meckern. Manchmal schleppte ich Karl an, für ihn war es Zwang, aber am Schluß war er stets begeistert.“
„Mein Vater kam nie“, werfe ich ein. Wunden die nicht vernarben wollen. Herzzerreißende Trauer, welche ich damals empfand, wegen der brüsken Ablehnung meines Vaters sich `solchen Humbug´ anzusehen, ist die einzige Gefühlsregung aus jener Zeit, die mir heute noch nahe geht.
Derweil ich dem Schmerz meiner Kindheit nachhing hatte Margit ahnungslos weiter geredet.
„…geschlossene Übergardinen, schräg zur Eingangstür die hell beleuchtete Kasperbühne, wie in einem kleinem Schauspielhaus. Und du tratest hervor, verbeugtest dich artig und riefest anschließend lauthals: `Das Spiel beginnt!´. Es machte dreimal Gong und der Vorhang erhob sich. Farbenfrohe Bühnenbilder an der Rückfront, man beachte, von dir selbstständig entworfen und gemalt. Trällernd sauste der Kasper von einer Ecke der Bühne zur nächsten, sah uns, frage ob allesamt anwesend sind und wie bejahten pflichtgemäß.“
„Margit, du kommst regelrecht ins Schwärmen und wie plastisch du erzählst. Eine halbe Neuaufführung möchte man meinen.“
„Ja, merkwürdig, wahrhaftig“, sagt sie leidenschaftlichen Ernstes, höchst konträr zu der Gelöstheit ihrer vorhergehenden Worte. Sie hebt ihr Glas in Augenhöhe und betrachtete sinnierend das bräunliche Funkeln des Branntweines im Schein der Kerze. „Vielleicht beschwingt mich die Erinnerung an eure Kindertage, weil unsere Ehe kinderlos geblieben ist. Karl wünschte sich Kinder, ich weiß es, trotz seines Bemühens dieses Thema taktvoll auszuklammern. Doch ich entschied anders. Denn ich spürte schon als junges Mädchen, Mutterschaft und Berufstätigkeit würden mich aufreiben. Ganz abgesehen von den Kindern. Ich wäre keine ehrenhafte Mutter geworden. Und überhaupt, was hätte ich meinem Nachwuchs angetan. Es laufen genügend Kinder herum, denen mangels Liebe, Zuneigung, Verständnis das Elternhaus zur Hölle wird. Irgendwann landen sie in meiner Praxis, sitzen im Warteraum verkrampft, ängstlich gleich einem heruntergekommenem Häufchen Unglück. Tja, das wollte ich meinen Kindern ersparen.“
Flüchtig trinkt sie schluckweise den Branntwein. Dann stellt sie zitternd ihr Glas auf die Schreibtisch- kante. Geschwind lange ich nach dem Fuß des Glases, damit es nicht umkippt.
„Entschuldige“, flüstert sie, um sofort das ihr scheinbar auf den Nägeln brennende anzufügen. „Nun, dem besagten verstandesmäßigem Verzicht wohnt allerdings ein Schönheitsfehler inne, der mir zuweilen schlaflose Nächte beschert. Jener großherzige Verzicht entsprang nämlich persönlichem Eigennutz. Meinen beruflichen Erfolgsdrang veranschlagte ich höher. Das Studium, die Promotion, meine praktische ärztliche Arbeit, der Professorentitel. Ich habe gewählt. War das impertinente Selbstgefälligkeit?“
Nachdenklich stützt sie ihren Unterkiefer auf den rechten Handteller. Im Nu bewirkt die atmosphärische Veränderung in unserer Unterhaltung, so scheint es, ein Umkehrung der Positionen. Peinlich und peinigend zugleich für mich. Freilich ist es menschlich anrührend Margit einmal verwandelt zu sehen. Belastet, unsicher, geschlagen von dem Kräfte zehrendem Auf und Nieder des Lebenslaufes und nicht immer nur die feinsinnig beobachtende Analytikerin vor sich zu haben. Aber verdammt noch mal, warum heute Abend. Ich will nicht das Schwache, Verletzliche an ihr entdecken. Bewahre, ich wanke selbst am Abgrund entlang und ringe um mein Gleichgewicht, da kann ich unmöglich Betrachtungen anstellen, weshalb und worüber sie strauchelte.
„Du wolltest erfahren, ob ich bei einem bestimmten Anlaß anders handelte, reagierte als ich eigentlich wollte. Das war schon der Fall, ja“, füge ich verlegen hinzu, denn mir kommt die Befürchtung, daß sie sich unangenehm berührt fühlen könnte, weil ich in solch taktloser Weise über ihre Empfindungen hin- weggehe, ohne einer Silbe der Erwiderung. Diesen Anfall von Ehrfurcht vor ihrem Schmerz schiebe ich rücksichtslos beiseite, hier nämlich geht es um mich. Jetzt bestehe ich auf meinen Egoismus. Und ich stoße nach mit der Bemerkung: „Mein Vater war im Spiel, ist das nicht sonderbar?“
„Eventuell sogar logisch, wenn wir bloß das auslösende Grundmotiv kennen würden, das brächte uns vorwärts“, sagt sie außergewöhnlich teilnahmsvoll. Gefaßt schenkt sie sich noch Branntwein in ihr Glas. Kein Zittern, keine deutbare Ruhelosigkeit mehr.
Mir behagt die Geschwindigkeit mit der sie ihre Betroffenheit ablegt und der Stimmungswandel nicht. Meinem Herzen widerstrebt derartiges Sich-Umstellen und die Fassung-Bewahren-Können. Stand dahinter die seltene, glückliche Gabe des Einfühlungsvermögens oder List, Tücke? Sollte diese Frau neben Klugheit, auch eine tüchtige Portion Gerissenheit besitzen und ich zur Figur geworden, allein den Anteil haben, der mir von ihr angewiesen wird, damit die Entwicklung jenen Verlauf nehme, der zum Ziele führt, welches sie erstrebt? – Wohlweislich werde ich mich hüten, ihr quasi die sie warnenden Verdächtigungen auszusprechen, und wäre es an dem, wie mir schwant, bewies das nicht eine innerliche Nähe sowie eine beträchtliche Ähnlichkeit unserer Charaktere?
„Was ist jetzt wieder? Du wolltest erzählen, Benjamin.“
„Ja doch, mir fehlt der Anfang. In meinem Kopf geht es drunter und drüber, die reinste Puzzelei“, lüge ich sehr gekonnt.
„Laß dich gehen und unterdrücke einmal die Versuchung dauernd deine Worte zu zensieren. Rede. Schnoddrig, ungelenk wegen mir, drauf los, aber sträube dich nicht länger der Wahrheit entgegenzutreten und mache dieser traurigen Hängepartie, die dein bisheriges Leben prägt, diesem Wollen und dem vermeintlichem nicht Können ein Ende. Bisher rennst du nur im Zickzack. Schlag die Gerade ein. Beziehe klare, verläßliche Standpunkte und tilge, merze aus was dich lähmt. Durchhaue den Knoten. Wir werden es schaffen, glaub´ mir“, beteuert Margit mit der eindringlichen Geste, daß sie meine Handgelenke ergreift und so sich ihre pulsierende Erregung unmittelbar körperlich auf mich überträgt.
Ich entschlüpfe dieser stürmischen Umklammerung. zünde mir eine Zigarette an, deren trockenen Geschmack ich beim ersten Zug inbrünstig genieße.
„Während der zwölften Klasse im Gymnasium war ich mit einem Jungen befreundet. Er kam zu Anfang des Schuljahres neu in unsere Klasse. Seine Eltern mußten aus beruflichen Gründen von Stuttgart nach Berlin. Michael hieß er, allerdings nannten wir ihn nur Wessi, und er hat die Bezeichnung ohne Widerspruch hingenommen. Obwohl er, wie er mir später gestand, erst im nachhinein erfuhr, daß üblicherweise die Westdeutschen in Berlin diesen Spitznamen verpaßt bekommen.“
Hier halte ich ein und fühle mich schon zurückversetzt in die Stimmungs- und Gefühlswelt jener Tage. Die Stille und das halbdunkel im Raum begünstigen meine innerliche Zeitenwanderung. Mir ist, als stünde Michael vor mir.
„Er hatte mittellange, strubbelig blonde Haare, blaue Augen, das was ich schwarzgelockter dunkler Typ nicht habe. Gegensätze üben offenbar magnetische Anziehung aufeinander aus. Mut besaß er, war kräftig gebaut und leichtsinnig draufgängerisch, ich eher zaghaft und schüchtern. Ihn ließ das kalt, wir wurden Freunde. Für sechs Monate, dann kam der Bruch, unerwartet und auf verletzliche Weise. – An einem Samstagabend trafen wir uns in der Disco am Kudamm, um mal wieder zügellos die Sau rauszulassen. Lernten dort zwei nette Mädchen kennen, tanzten, trieben allerlei Unfug, tranken etwas Alkohol, er gewiß mehr als nötig, doch betrunken war er keineswegs, höchstens leicht aufgekratzt. Am frühen Sonntagmorgen, ungefähr halb drei, verließen wir den Laden. Michael, dieser Wahnsinnsknabe, wollte mit seinem Motorrad nach Hause fahren und es kostete mich Mordsanstrengung ihm das auszureden. Wir sind dann mit der S-Bahn Richtung Zehlendorf, wo er inzwischen ein eigenes Zimmer bewohnte, weil er den Frust daheim nicht mehr ertragen konnte, aber worum es dabei ging, erzählte mir Michael nie. Vom Bahnhof waren es noch zehn Minuten bis zu seiner Wohnung. Wir liefen durch die menschenleeren Straßen, verrückt und albernd hin und her hopsend. Plötzlich ruft er: He, guck dir das an, die Karre ist super! Ich entgegne, du und dein närrischer Motorradspleen, das ist ja abnormal. Junge, ´ne achthunderter BMW, sagt er und stürzt davon und umtänzelt die Maschine, daß man meinen konnte, die heilige Kuh vor sich zu haben, welche er abgöttisch anbete. Vier Zylindermotor, wieviel Power in dem Ding steckt, belehrt er mich und knallt mir unentwegt irgendwelche technischen Daten an den Kopf. Wie er die Seitenspiegel betrachtet, winkt er mich zu sich heran. Komm her! Und ich frage, was gibt´s? Sagt er, die beiden Spiegel würden gut an mein Lenkrad passen, du stehst Schmiere. Bist du bescheuert, sag´ ich, seit wann machst du lange Finger? Ohne mich! Du willst mein Freund sein, giftet er mich an. Ich bin dein Freund… na also, dann mach´ schon, nur beeile dich, Kerl, sage ich und postiere mich auf dem Gehsteig, die Hausfront im Auge behaltend. Gereizt trete ich von einem Bein aufs andere, denn mir ist ziemlich mies zumute. Da sehe ich jemand hinter den Gardinen eines Fensters im ersten Stock vorlugen. Und dann höre ich stampfendes Trampeln, Gepolter. Im Hausflur wird Licht eingeschaltet, Rufe erschallen. Wie wild geworden bläke ich: Mensch, wir müssen verduften! Nimm die Pfoten von dem Mistding! Ich umklammere Michaels Oberarm, will ihn fortziehen. Aber er fummelt weiter mit seinem Taschenmesser an den Schrauben herum. Er wird hektisch, schleudert mich gewaltsam von sich. Ich falle, springe jedoch blitzschnell wieder hoch und renne in panischer Furcht davon… weg zur gegenüberliegenden Straßenseite, wo eine schmale Nebengasse abbiegt, die ich hinunter flitze, ohne auch nur einmal zurückzuschauen. – Michael nicht aus dieser Patsche geholfen zu haben, bereute ich nachher sehr, als ich am Ende dieser Nebengasse anlangte und mich erschöpft an die Hausmauer lehnte, und ich fühlte mich schäbig, widerlich. Vor allem der Gedanke, was ihm zugestoßen sein mochte, bereitete mir Kopfzerbrechen.“
„Tja, gut oder ungut ist wohl passender, bloß welcher Zusammenhang besteht -“
„Einen Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich kehrte nämlich um und tatsächlich kam mir Michael entgegen. Seine Arme hingen schlapp herunter und er humpelte. Wie er so vor mir stand, machte er einen zerzausten, jämmerlichen Eindruck. Worte der Entschuldigung währte er mit lässiger Handbewegung ab. Ach, ich habe den Stuß verzapft, hilf mir lieber, sagte er, ich muß mir meinen Knöchel verstaucht haben. Stützend bot ich ihm meine Schulter und schleppte ihn in einen unverschlossenen Hauseingang. Die Beine angezogen setzte er sich auf den kalten Steinfußboden. Mit dem Handrücken rieb er seine Nase, aus der einige Tropfen Blut floß, das er durch mehrmaliges Schnüffeln zurückhalten wollte. Möchtest du mein Taschentuch, es ist sauber. Ich griff in meine Jackentasche und reichte ihm das Taschentuch. Ja, nun, er nahm das Taschentuch nicht einfach so, sondern berührte streichelnd die Finger, drückte sie behutsam und zog mich sanft auf den Boden. Diese Berührung war keinesfalls eine jener Berührungen, die wir schon hatten. Vielmehr lag darin ein Grad von Empfindung, zu dem ich ihn niemals für fähig gehalten habe. Irritiert und unsicher wurde ich. Unsere Gesichter näherten sich einander und ich sog den Atem ein, den er ausstieß. Er rieb die Stirn an meinem Hals, wobei seine Haare meine Lippen umschlossen. Er weinte. Ich spürte die Feuchtigkeit der Zunge, mit der er über meine Haut strich. Unversehens fühlte ich versponnen zu sein in ein Verhältnis zu ihm, das ich schwer zu deuten wußte. Zwischen Entsetzen und Erstaunen pendelte ich, die Gefühlswelt in mir geriet außer Kontrolle. Körperlich reagierte ich verkrampft und mit regungslosem Erstarren. Er schmiegte sich immer heftiger an mich. Von der Brust bis zu den Füßen vibrierte er, wie eine Harfe, deren Saiten man in Schwingung versetzt. Mir wurde erneut himmelangst, aber diesmal auf eine befremdliche Art und Weise mit einer vielfältigen Spannung verbunden, die mich fast willfährig tatenlos machte. Ich wußte nicht wohin und was tun. Aber insbesondere, was tat er? Die Fäuste gegen seine Hüften stemmend bemerkte ich die kraftstrotzende Anspannung der Muskeln. Ungehemmt steigerte sich Michael in eine Ekstase hinein, daß jegliches wehrende Aufbäumen meinerseits völlig sinnlos gewesen wäre. Er stöhnte. Entmutigt schloß ich die Augen, aber vor dem inneren Auge entstand das Bild längst vergessener Schmähungen, dem ich nicht entrinnen konnte. Wäre es doch in tausend Splitter zerfallen. Ich wollte es verjagen. Ich wollte es zertrümmern. Ich wollte es wegscheuchen. Doch als sei ich nicht mehr Herr meiner Sinne, entzog sich die Vorstellungskraft der Bestimmung. Was ich sah? Das ehemalige Kinderzimmer und ich auf dem Bett onanierend. Vater kommt herein, unerwartet. Erblickt und erkennt die Situation. `Du Ferkel, ääh´, spricht er und geht. Jenes `äah´ war das Schlimmste. Dieses Bild in jenem Moment! Wutentbrannt ohrfeige ich Michael und kreische haßerfüllt: `Du Ferkel, äah!´ Wir redeten niemals wieder miteinander.“
Was ist wohl aus ihm geworden, denke ich und presse zornig Daumen und Zeigefinger auf den glimmenden Zigarettenstummel im Aschenbecher. Ob er auch mit seinem Schicksal hadert oder hat er es angenommen? Weshalb hocke ich überhaupt sinnlos in der Veranda herum und bin nicht nach München gefahren. Die Stadt deren buntes Lichtermeer so lockend und vielversprechend dort drüben flimmert. Das Münchner Nachtleben wäre eine Sünde wert, meint jedenfalls Onkel Karl. Sünde, welche?
„Hahaha…“
„Du lachst, das ist direkt beängstigend“, witzelt Margit verschmitzt und mit fast kokett wirkenden Augenaufschlag.
„Ach tatsächlich? Pha, nein ich dachte daran, daß ich heute Abend hätte lieber ausgehen sollen, mich amüsieren. Hm…, seit ich hier bin, habe ich euer Grundstück kaum verlassen und weder etwas von dem Ort gesehen, noch München kennengelernt.“
„Jammerschade, wirklich, mein Junge. Es würde dir sicherlich ungemein zum Vorteil gereichen, wenn du dich Mal unter Menschen mischst. Abschalten, neue Eindrücke sammeln. Statt dessen verbuddelst du dich, wie ein tagscheuer Maulwurf. Warum? Wirfst mir nichts dir nichts das Studium über den Haufen, kündigst spontan das Mietverhältnis, brichst total alle Brücken hinter dir ab, erscheinst bei uns und willst dich per Strick beziehungsweise per Messer, ganz nach Belieben, in´s Jenseits befördern. Bravo! Zumal die Aussicht, du verläßt unser Haus im Sarg, für Karl und mich keine berauschende ist.“
„Margit, es tut mir leid, ich wollte euch nicht in meine verkorksten Lebensumstände hineinziehen“, sage ich und verschränke die Arme vor der Brust. „Gewiß fällt dir mein pubertäres Gefasel auch auf die Nerven. Nur, was sind vierundzwanzig Jahre, die zudem letztlich doch in vorgezeichneten und beschränkten Lebensbahnen verlaufen. Wer eintönig lebt, hat wenig zu erzählen. Kindheit, Schule, Studium – Finis.“
„Herrje! Also jetzt spitze mal deine Lauscherchen und höre mich aufmerksam an“, platzt es Margit heraus, indem sie mit den Fingerknöcheln mehrmals auf die Schreibtischplatte pocht. „Du redest, als seist du ein seniler, altersschwacher Opa am Schluß seiner Tage. Aber du bist jung, das blühende Leben liegt vor dir. Ich glaube der Tod deiner Mutter brachte die Lawine ins Rollen, an deren Endpunkt die Selbstverleugnung steht. Nämlich das schaudernd wahnwitzige Empfinden, mit ihrem Ableben sei deine Existenz wertlos geworden. Sie war treue, geduldige, einfühlsame Vertrauensperson in einem für dich und wahrhaftig, die entschiedene Abnabelung von ihr ist dir niemals gelungen. Daran besteht für mich kein Zweifel. Oder irre ich?“
Ich verbiete mir jegliche Entgegnung. Bittend schaue ich Margit an, nicht noch tiefer einzudringen in die schmerzlichen Gebiete meines Ichs.
„Keine Antwort ist auch Antwort genug. Und dann der fortwährende zermürbende Streit zwischen euch beiden. Zwischen Vater und Sohn. Nebenher gesagt, anhand deiner soeben geschilderten Geschichte, erfuhr ich erstmals, daß du gleichaltrige Freunde hattest. Du lebst zu sehr abgeschlossen, im eigenen Saft schmorend, mein Bester. War es dieser Michael, den du haßtest?“
„Blödsinn, weshalb auch?“ erwidere ich etwas verblüfft.
Aber das Wort `haßerfüllt´ fiel.“
„Hab´ ich gesagt?“ Margit nickt. „Rutschte mir geflissentlich so raus.“
„Dies glaube wer will. Ich vermute, du meintest deinen Vater.“
„Ja, gut möglich“, sage ich zaghaft, wobei ich das bitter gespaltene Gefühl von Verzweiflung und Erleichterung verspüre.
„Na bitteschön, unausweichlich gelangen wir zum Kern der Dinge“, spricht sie bedeutsam, da ich ihre Annahme bestätige.
„Ist es ein Wunder, daß ich ihn… ihn verachte?“ formuliere ich, bedachtsam den Gehalt meiner eigentlichen Stimmungslage abschwächend. „Jedenfalls sind die meisten Kindheitserinnerungen eher betrüblicher Natur. Er hinterging uns, die gesamte Familie. Prügelte unsere Mutter, wenn man das sehen muß, wie schändlich. Alles zertrampelte er, meine naive Vertrauensseligkeit, mein redliches Anhänglichkeitsbedürfnis. Gewöhnlichste menschliche Zuneigung ist ihm ein Greuel, so schien es mir immer. Am Nachmittag meines zehnten Geburtstages, zerschlug ich beim Geschirrabwasch sein prunkvollstes Bierglas, aus Unachtsamkeit. Und er, er sagte, am besten wäre es, mich würde es gar nicht geben. Warum solch bösartige Abneigung? Was habe ich ihm getan? Ein andermal spielte ich mit Gefährten aus der Nachbarschaft Hasche im Hof. Zum Mittagessen wurde ich gerufen. Doch ich gehorchte nicht und blieb. Alsbald schickten sie Thomas. Instinktiv ging ich in Abwehrstellung, aus Furcht mein Bruder wolle mich gewaltsam zwingen. Kurioserweise aber gebärdete er sich freundlich und ungemein anständig. Schon aus der Ferne schwafelte Thomas, ich solle keineswegs ängstlich sein, er komme nur um mir zu verraten, Vati sei von der Tagung heimgekehrt und verteile gerade Geschenke. Ihm, prahlte Thomas, hätte er einen Baukasten gekauft. Betört durch diese schöne Glücksaussicht ließ ich die Spielkameraden kommentarlos zurück. Eilte zum Hauseingang, die Treppe hoch. Drückte stürmisch den Klingelknopf. Sperrangelweit wurde die Tür geöffnet. Er stand da, in seiner damaligen massig-bulligen Größe.